|
Fünf Mann in einem Boot
Sail2005
Prolog
Nennt mich
Gevatter. Es war vor einigen Wochen – is’ ja auch
egal – ich hatte jede Menge Geld über, sonst aber
nichts, was mich an Land
besonders gefesselt hätte. Da kam mir der Gedanke, ein wenig
zur See zu gehen
und mir den nassen Teil der Erde anzusehen. Das ist eigentlich so gar
nicht
meine Art, mir die Grillen zu vertreiben, aber irgendwie muss ich ja
meinen
Blutkreislauf anregen.
Immer, wenn sogar
ich den Eindruck gewinne, daß sich mein
Gesichtsausdruck zu grimmig gestaltet und ich alle Hoffnung verliere
den
kommenden, hoffentlich grau-neblichten November mit einer angenehm
milden
Depression zu verbringen, wenn also auch der letzte Rest von Schwermut
zu
verschwinden und einem belanglosen Gefühl der
Alltäglichkeit zu weichen droht,
so daß es starker sittlicher Grundsätze bedarf, um
mich davor zu bewahren die
Zuversicht darüber zu verlieren, daß mir im
Zweifelsfall immer noch die
Möglichkeit bleibt die schlimmsten Idioten in Streifen zu
schneiden – dann ist
es meines Erachtens höchste Zeit, so schnell wie
möglich etwas zu unternehmen,
und sei es, sich einem unendlichen, grauen, endlos
abgründigen, ewig wogenden
Ozean auszusetzen, hoffend, daß sich etwas von seiner
deprimierend grenzenlosen
Allgegenwart der gepeinigten Seele mitteilt.
Manch einer
würde sich resignierend vor den Fernseher
setzen. Ich begebe mich einfach an Bord. Dabei ist nichts
überraschendes. Ohne
es zu wissen haben die meisten Leute hin und wieder auf ihre Art dem
Mittelmeere gegenüber dieselben Empfindungen wie ich.
Anfang vor dem
Anfang
Wie jede
Geschichte, so hat auch diese, die nebenbei bemerkt
den Vorzug hat, wahr zu sein, einen Anfang. Bei den
vielfältigen Verwicklungen,
die das Leben so bereithält fällt es bisweilen schwer
den Punkt zu finden, an
dem sich ankündigte, was anzufangen je schon begonnen hatte.
Um solcherlei
Probleme zu umgehen kann es sich daher als günstig erweisen
einen Anfang zu
wählen, der seinen Ursprung vor Beginn des Geschehens hat,
doch ach … auch
solches ist hier schwer zu bestimmen und je mehr ich mich zu entsinnen
versuche
wie der Ereignisse Hergang sich im Vorfelde gestaltete, umso unklarer
wird mir
der Sinn des Ganzen.
Nun
läßt sich ein Moment greifen, der als Ereignis zwar
unbedeutend, in seiner zeitlichen Verortung aber früh genug zu
liegen scheint,
so daß ich damit ansetzen will, daß mir die Ehre
zuteil wurde gemeinsam mit
unserem Skipper zum Sammelpunkte zu fahren, zu welchem seine Wohnstatt
bestimmt
war. An der ganzen Art und Weise den Wagen sicher durch die brandenden
Wellen
aus Blech und Kunststoff zu führen erkannte man schon hier an
Land den
dominanten Führer, das Alphatier, den unerbittlichen Master
und Comander, der
mit gottähnlicher Gewalt unter Einhaltung eines eisern
disziplinierten Regimes
seine Mannschaft sicher zu führen weiß.
Wie so oft, so
erwies sich auch hier der strenge Meister als
guter Wirt, so daß die, sich langsam einfindende, Crew keine
Not zu leiden
hatte. Übermütig von der Fülle entbrannte
eine ziemlich unsinnige Diskussion
über die nötige Menge an Knoblauch mit der das Mahl
zu versehen sei, da zu
berücksichtigen war, daß außer uns noch
weitere Passagiere an der
bevorstehenden Flugreise teilnehmen wollen werden. Eine unsinnige
Diskussion,
denn im Angesicht der Tatsache, daß wir uns bald im Lande wo
der Knoblauch
blüht aufhalten werden, hätte ruhigen Gewissens auf
dieses delikate Gemüse
verzichtet werden können.
Es ist prinzipiell
unverständlich, weshalb es nötig ist,
sich zuerst in die Luft zu begeben, wenn man sich vom festen auf das
flüssige
Medium begeben will, gleichwohl war dieser sublimative Schritt
nötig, weshalb
wir uns nach einer kurzen, aber erholsamen Nacht zum Flughafen begaben.
Es
herrscht bis heute Uneinigkeit über die Qualität des
Schlafes, der uns Reisende
in den weiträumigen Gemächern der Herberge umfing.
Leicht erregbare und
hellhörige Gemüter mögen sich beklaget haben
ob der mannigfaltigen Geräusche,
die die Stille der Nacht durchrissen, ich für meinen Teil
fühlte mich gestärkt
und den Fährnissen der nächsten Stunden gewachsen.
Auch fühlte ich eine starke
innere freudige Erregung, die der Gedanke an ein opulentes
Frühstück auf dem
Flughafen in mir erweckte. Ich empfand es schon immer als ein
besonderes Stück
Lebensqualität da zu verweilen wo andere hastig
einherstürzen und was kann es
dafür einen besseren Ort, eine bessere Situation geben, als
das geschäftige
Treiben eines Flughafens mit seiner beängstigend verwirrenden
Weitläufigkeit,
die von Anzeigetafeln, Geschäften und Personenkontrollen
zerrissen wird, oder vom
enervierenden Krach einer Bombe, die ein Terrorist zur Untermalung
seines
politischen Meinungsbildes zurückgelassen hat. Inmitten diesen
Trubels sollte
also das Frühstücksmahl stattfinden, das
außer dem pragmatischen Ziele der
körperlichen Stärkung noch das arrogante Ziel der
Demonstration unserer
überlegenen Lebensart verfolgte, die im wesentlichen darin
bestand Zeit zu
haben. Zeit, die wir durch die Vorschrift der frühzeitigen
Anwesenheit vor dem
Fluge gleichsam geschenkt bekamen und daher umso mehr
genießen konnten. Zeit,
die im übrigen auch alle anderen Passagiere geschenkt bekamen,
aber sie merkten
es nicht, so wie sie nie etwas merken, das mit ihrem Leben
zusammenhängt, denn
sie befinden sich in einem ständigen Zustand der Angst etwas
von ihrem Leben
nicht mitzubekommen, so daß sie panisch und aufgehetzt eben
diesem beständig
hinterherlaufen, ohne sich je umzuwenden oder nach der Seite zu
schauen, und so
nicht bemerken, dass sie es dabei Stück für
Stück verlieren.
Vor das
Frühstück hat die zuständige
Behörde das Einchecken
gesetzt. Wer dies für bürokratisch und unsinnig
hält, der sollte einmal erleben
wie schwer es ist den zuständigen Sachbearbeitern
klarzumachen, dass sich die
Zahl der Reisenden einer Gruppe nicht verändert, wenn eine
ursprünglich gemeldete
Person fernbleibt, dafür aber eine neue
hinzustößt, mithin aber auf jeden Fall
für alle gezahlt wurde, weshalb es unerheblich ist, wie diese
heißen, zumal
sowieso niemand glaubhaft machen kann, dass die Bordcrew ernsthaft
bemüht sei
die Namen zu memorieren. Was soll es also, aber - ach – es
muß wohl sein, und
die moderne Technik wird bemüht, um den Fall mit letzter
Konsequenz
klarzustellen, wobei dem betroffenen Reisenden die ganze Zeit
über nicht
wirklich wohl ist. Ich kann dies mit Bestimmtheit versichern, denn bei
diesem
verspätet angeheuerten Fähnrich handelte es sich um
den Verfasser dieser
Geschichte, der an dieser Stelle gern zugeben will, dass sich der
Aufwand beim
Einchecken am Ende doch noch lohnen sollte, aber dazu später
mehr.
Vor dem
Flug
So, wie der Bauer
den Ochsen oder das Pferd, stellen die
Fluggesellschaften das Warten vor den Flug. Schwer ist es dem
Niegereisten zu
beschreiben, wie das Warteareal eines Flughafens beschaffen ist.
Würde Luzifer
seine Höllenkreise um einen Achten zu erweitern suchen, so
könnte er sich
praktikable Anregungen auf Flughäfen suchen. Der unbedarfte
Reisende mag sich
daran nicht stören, aber wer mehr vom Leben verlangt, als
trocken und vom Winde
geschützt herumzusitzen, der wird sich des Eindruckes nicht
erwehren können,
dass man ihn hier nicht wirklich dahaben will. Umso verwunderlicher ist
es da,
dass man für eine so lange Zeit zu warten verdammt ist. Nun
sollte es im Falle
unserer Reisegesellschaft ja eigentlich zur Demonstration
überlegener Lebensart
kommen, was mangels gastronomischer Einrichtungen im Areal hinter der
Eingangskontrolle aber nicht ging. So belagerten wir denn
gemeinschaftlich mit
den anderen Verdammten den Getränkeautomaten und bunkerten
lebenswichtige
Medizin im „Dienstfreien Geschäft“.
Der in südlichen Gefilden reisende Europäer sollte
stets
darauf bedacht sein, dass sein überzüchteter und vom
Wohlstand verzärtelter
Körper niegeahnten Bedrohungen ausgesetzt ist. Zuallererst gilt die alte
englische
Kolonialregel: „Peel it, cook it or forget it!“ Der
versierte Reisende
wird sich zusätzlich dadurch absichern, dass er seine
Reiseapotheke mit einer
hinreichenden Menge eines schottischen Hochlandgewächses
versieht, wobei hier
auch günstigere Provenienzen den Anforderungen
genügen. Romantiker werden sich
für eine Seereise mit jamaikanischem Zuckerrohrdestillat
versehen, welches sich
ebenfalls in langjährigen britischen Studien als wirksam
erwiesen hat.
Obwohl
man die Warterei auf den Flug als eine Art
stationärer Reisekrankheit auffassen kann sei vor allzu
eifriger
Medikamentierung an dieser Stelle gewarnt.
Der Flug
Da es sich bei
dieser kleinen Schrift um eine Reisebericht
handelt, dem eine Reise zur See zugrunde liegt, soll an dieser Stelle
nur
erwähnt werden, dass es sich um einen ganz
gewöhnlichen Flug handelte, bei dem
es im Großen und Ganzen lediglich darum ging, wie es einer
großen Anzahl von
Menschen, die auf geschickte Weise in einer noch
größeren Menge von Metall und
Kunststoff verpackt wurden, gelang, vom Boden abzuheben, sich
Vogelgleich,
allerdings ungleich schneller, durch die Luft zu bewegen und in
südlichen
Gefilden sicher wieder aufzusetzen. Das ganze passierte auf so
unspektakuläre Weise,
dass ich mich kaum noch an Einzelheiten zu erinnern vermag, sieht man
einmal
von der exzellenten Klimaanlage ab, die es vermochte, die Luft so gut
umzuwälzen und meinen Körper so weit
herunterzukühlen, dass es einem kleinen
und unscheinbaren Virus, dessen Träger sich irgendwo weiter
vorn aufhielt,
gelang, sich so in meinem Körper einzunisten, dass
für den Rest der Reise nicht
von völliger Funktionstüchtigkeit gesprochen werden
kann.
Es kann also nicht
schaden etwas warme Bekleidung mit in den
Flieger zu nehmen
Durchs wilde Kurdistan
…
sind wir nicht gefahren, nachdem uns ein sehr pünktlicher
und hilfsbereiter Fahrer vom Flughafen abholte, aber es würde
mich schon sehr
wundern, wenn es dort wesentlich anders aussehen würde als in
den Landstrichen,
die wir zu durchqueren hatten, um zum Boot zu gelangen. An dieser
Stelle wird
in Reisebeschreibungen gern geschildert, wie der Fahrer seinen
Passagieren
durch kamikazehafte Fahrweise durch enge Serpentinen und über
schmale Bergpässe
zu einer zünftigen Nahtoderfahrung verhilft. Neue breite
Straßen und ein eher
behäbiges Gemüt seitens des Fahrers halfen, uns vor
einem raschen Verkehrstod
zu verschonen, so dass wir auch ohne Anstrengung die Waren begutachten
konnten,
die von Händlern an den Straßenrändern
feilgeboten wurden. Im Großen und Ganzen
handelte es sich dabei um irdenes Geschirr, wie man es in rustikal
wirken
wollenden Bodrumer Restaurants zur Präsentation der Speisen
nutzt, und um
nahezu lebensgroße Nachbildungen von Schafen, die wie Lamas
aussahen und
möglicherweise eine bizarre Form von Sexspielzeug darstellten.
Bodrum
| Aufmerksame
Bewohner dieser Kugel stolpern früher oder
später über den seltsamen Umstand,
dass manche Menschen so aussehen wie sie
heißen. Mit Bodrum ist das ähnlich. Bodrum
– was für ein Wort – klingt wie eine
Mischung aus Bodden und Bochum, sieht auch so aus und leben
möchte man da
ebenfalls nicht unbedingt, sieht man einmal von Grönemeyerfans
ab. Angeblich
zieht es junge und vor allem partysüchtige Menschen in Scharen
in diese Stadt,
es gelang mir aber nicht zu erkennen warum. Das wirklich
Schöne oder sagen wir
mal praktische an Bodrum ist der Hafen. Häfen bringen es mit
sich, dass dort
Schiffe ein Zuhause finden und das unsrige wartete bereits darauf von
unserer
Crew übernommen zu werden – theoretisch –
aber sowas ist alles nicht mehr so
einfach in unserer Zeit, weshalb sich der größte
Teil der Crew gleich wieder
aus dem Staube machte, um Vorräte zu beschaffen, so dass
letztlich der Skipper
allein den Übernahmeprozeß zu regeln hatte. Das
Schöne an unserem Skipper ist,
dass er das dann auch tut. |
 |
Wie
einfach war es doch zur großen Zeit der Segelschiffe an
Bord zu kommen, anzuheuern, die Welt zu sehen. Zu Zeiten, als
Britannien noch
Seemacht war reichte es sich in einer Hafenstadt in die
nächste Kneipe zu
setzen und ein Bier zu bestellen. Schnell fanden sich nette oft mit
schicken
Uniformen versehene Herren, die einem noch ein zweites Bier
spendierten,
vielleicht bekam man sogar noch einen Schilling geschenkt …
jedenfalls erwachte
man dann bereits am nächsten Morgen mit mächtigem
Kater und einer ansehnlichen
Beule versehen auf einem Schiff. Bei Sail 200X läuft das ein
wenig anders und
vor allem ohne Beule, aber dafür ist man der
Bürokratischen Willkür der
Charterfirmen ausgesetzt.
Der
ursprüngliche Plan bestand darin das Boot zu
übernehmen,
Vorräte zu Bunkern und da abzuhauen. Der spontan erstellte und
an die
aufgezwungenen Bedingungen angepasste Ersatzplan sah vor die Nacht
notgedrungen
im Hafen zu verbringen, um dann gleich beim ersten Tageslicht Land zu
gewinnen,
äh verlieren. Gegen 9.30 Uhr tuckerten wir dann auch
tatsächlich los.
Es
gehört zu den fundamentalen Erfahrungen dieser Reise,
dass Pläne ziemlich genau dasjenige Szenario beschrieben, das
mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit nicht eintrat. Der geneigte Leser, der
mit dem
Gedanken spielt sich dereinst einmal an einem Törn bei Sail
200X zu beteiligen
sollte sich aber auch darauf nicht allzu sehr verlassen.
Kacheln
Wie schön
und ausdrucksstark ist doch unsere Sprache und wie
vielseitig weiß sie Worte einzusetzen. Manchmal entbehrt dies
einer gewissen
Logik, ohne dabei an lautmalerischer Kraft zu verlieren.
 |
Wer
schon einmal Gelegenheit hatte sich in einem Badezimmer
aufzuhalten konnte einen lebendigen Eindruck davon gewinnen, wie glatt,
eben
und gleichmäßig eine Wand sein kann, wenn ein
kundiger Handwerker die Kacheln
an ihrem Ort platzierte. „Still und glatt lag die See vor dem
Bug unseres
Schiffes …“ heißt es oft in
wildromantischen Abenteuerromanen und rein optisch
könnte man so was spontan für kacheln halten, aber
nein – wenn es der große
Macher dieser Kugel kacheln lässt, dann sieht das anders aus.
Wind und Wellen
gebärden sich in bizarr unmanierlicher Weise, um mit den ihnen
ausgesetzten
Booten ein Gesamtkunstwerk aufzuführen, dem wir teilhaftig
wurden, sobald sich
unser Mast über die Grenzen der schützenden Bucht von
Bodrum schob. Nur von der
dreiviertel Fock getrieben gierte unser französischer
Mistkahn, wie |
|
ihn unser
Skipper liebevoll nannte, mit an die zehn Knoten durch die
Straße von Kos. Mit
einer Mischung aus Angst, Faszination und warten auf die Seekrankheit
gaben
sich die Landratten dem Auf und Ab der Wellen hin. Sollte so ein Boot
nicht
vielleicht doch größer sein als die es umgebenden
Wellen? Erstaunlich war an
dieser Stelle auch wie sehr die Versicherungen des Skippers in keinster
Weise
beruhigend wirkten, dass das auch noch stärker gehe und man
erst mitreden
könne, wenn man nachts auf dem Atlantik einen Sturm mitgemacht
habe. Die
Vielzahl der Segel, die an diesem Tage auszumachen war zeigte aber
deutlich,
dass die aktuellen Bedingungen aus seglerischer Sicht so wie sie waren
auch
gewollt waren; vielleicht lag es aber auch einfach daran, dass Sonntag
war und
die Leute einfach Zeit hatten und sich im übrigen nicht so
leicht vom Wind
einschüchtern ließen wie ich.
Zumindest
schien ich nicht anfällig für die Seekrankheit zu
sein und das war doch sehr beruhigend, denn bei dreißig Grad
Krängung und
wackligem Stand kotzt es sich einfach nicht so gut, zumindest
würde es Abzüge
in der B-Note geben.
Das
Tagesziel Knidos wurde am frühen Nachmittag erreicht.
Dieser Ort hat reichlich Geschichte, die man betreten, sehen, anfassen
und
sogar photographieren darf. Nur einstecken darf man nichts denn hier
ist jeder
Stein Geschichte und da kennen die türkischen
Behörden ja nun gar keinen Spaß.
Davon abgesehen sah es dort aber genau so aus wie in den anderen Ecken
der
Türkei, die ich bis dato bereiste. Der Unterschied bestand im
wesentlichen
darin, dass Knidos vor über 2000 Jahren von Griechen erbaut
wurde, was
allerdings öfter mal in der Türkei vorkommt, wobei es
bisweilen schwer fällt
die griechischen Gebäude von den türkischen zu
unterscheiden, wenn man kein
Historiker ist. Da wir nicht alle das Glück haben einmal vor
Unerbittlichem
stehn zu können, stellte ich mich in das alte Amphitheater und
sagte ein
Gedicht auf. Solches macht nämlich sicher und stolz und ich
kann jedem nur
empfehlen das Gleiche zu tun, wenn man mal so ein altes Theater
besichtigt.
Mich ergriff ein ungeheures Hochgefühl – ich war
ganz besoffen davon. Leider
bekam ich keinen Applaus, da das Theater vor etwa 1350 Jahren
geschlossen
werden musste, weil eine arabische Flotte, grausig und groß,
die Stadt in
Schutt und Asche legte.
Das
Boot war vorschriftsmäßig am Steg festgemacht, als
noch
ein sehr sympathisches schweizerisches Ehepaar den letzten freien Platz
besetzte. Sie eigneten ein wunderschönes altes
hölzernes Boot, das
augenscheinlich noch sehr gut in Schuß war. Die Dame des
Bootes prägte im
folgenden Gespräch den Satz des Tages. Als ein Katamaran in
die Bucht einfuhr
und in der zweiten Reihe festmachen zu wollen drohte, kommentierte sie
dies: „Was
ist denn das für ein Geschwür? Die dürfen
aber nicht neben uns festmachen. So
Leute gehen mir nicht über den Bug.“
Es
gibt in Knidos eine Taverne in der man recht ordentlich
essen kann. Es gibt frischen Fisch, den man sich vorher aussuchen kann
und der
dann frisch zubereitet wird – nach Wunsch – und
wenn man beispielsweise viel
Knoblauch dran haben will, dann machen die das auch so, aber das kann
man sich
im Prinzip sparen, denn der Knoblauch schmeckte irgendwie nicht so
recht nach
Knoblauch; eigentlich gar nicht. Der Skipper war jedenfalls nicht
amüsiert und
ich fror, da der Virus aus dem Flieger anfing sich ernsthaft mit meinem
Immunsystem anzulegen.
Ihr segelt wohl nicht gerne
lautet
der Kampfruf des Skippers, den er jedem provozierend
entgegenbellt, der es wagt mehr als hundert Faden am Tag mit Motorkraft
zurückzulegen. Am dritten Tag der Reise traf dieser Vorwurf
nahezu alle Segler
der Umgebung. Von Knidos ging es nach Datca bei 1-3 Bft im
Schmetterling vor
dem Wind. Leider total überhaupt nicht in der brausenden Fahrt
wie am Vortag,
aber dadurch hatten wir Gelegenheit mal das ganze Gurtzeug
auszuprobieren und
an Backbord etwas Tarzan zu spielen. Datca in Sicht –
komisch, ich muss
irgendwie immer an ein billiges Auto denken, wenn ich an diesen Teil
der Reise
denke – änderten sich die Bedingungen. Der Wind
frischt auf und kam ziemlich
exakt aus der Richtung in die wir wollten. Da wollten übrigens
noch etliche
andere auch hin, was sie durch uniformes Verhalten signalisierten. Sie
strichen
weit, weit draußen die Segel und tuckerten
gemächlich in den Hafen hinein. Der
Skipper brachte (mal wieder) seinen Spruch und erläuterte uns
was es mit dem
Kreuzen auf sich hat. Ich befürchtete nach der
Vorankündigung etwas mit dicken
Holzbalken und Nägeln, aber eigentlich wollte er nur gegen den
Wind segeln, was
er im praktischen Teil seines Unterrichts dann auch gründlich
mit uns
exerzierte – er ist halt ein Pädagog’.
Nach einigem hin und her bekamen wir die
Manöver recht ordentlich hin und schipperten dramatisch an der
Mole vorbei bis
in Wurfweite unter Segeln an den Steg heran, so dass dann auch jeder
wusste aus
was für GFK wir geschnitzt sind. So waren wir denn auch das
Thema in den
Hafenkneipen und Restaurants und man zerriß sich das Maul
über uns, also das nehme
ich jetzt jedenfalls mal so an, denn wir waren nicht da, weil viel zu
teuer und
überhaupt ist es doch irgendwie nicht einzusehen, dass man ins
Ausland fährt,
nur um dann mit anderen Deutschen zusammen deutsches Essen zu mampfen
und
deutsches Bier zu trinken. Es empfiehlt sich jedenfalls drei
Querstraßen weiter
und dann links zu gehen, wo man nach Einheimischen Ausschau
hält, die an der
Straße sitzen und essen. Da setzt man sich dann einfach dazu,
sagt noch höflich
Schalom und macht dann der jungen Dame mit der Schürze mit
raumgreifenden
Armbewegungen klar, dass sie einfach von allem was bringen soll, was
sie so da
haben. Die machen das dann recht flink und es werden bestimmt alle satt
und das
kostet dann so viel wie eine Portion am Hafen, schmeckt sowieso besser
und
irgendwie sogar ein bisschen nach Knoblauch.
Muss
ich eigentlich erwähnen, dass wir Datca vom Steg weg
unter Segeln verlassen haben?
Der Fjord
| Ich
vertrete schon länger die Theorie, dass die Götter
der
Antike von norwegischer Abstammung waren. Die eher weichlichen
darunter, also
Zeus & Co. haben sich dann halt irgendwann ans Mittelmeer
abgesetzt und
ihren eigenen Laden aufgemacht, mit ihrer eigenen Kundschaft, die
Prometheus
(hatte ich eigentlich erwähnt, dass es das gleichnamige
Gedicht des großen
Ohjann Golgo van Fontheweg war, das ich in Knidos so ergreifen
vortrug?) aus
den örtlichen Baumaterialien zusammenmanschte und die dann vom
Olymp aus
verwaltet wurden. Später drängte sich dann ein
galiläischer Fischerkult in den
Markt, aber das ist eine andere Geschichte. Die alten Götter
hatten es
jedenfalls eigentlich nur auf das milde Klima abgesehen,
darüber hinaus aber
gerne mal Heimweh, weshalb ein zünftiges Terraforming
veranstaltet wurde, das
aber mangels qualifizierter Mitarbeiter mehr gewollt als gekonnt
ablief. Das
Ergebnis macht die Mittelmeergegend bis heute für Segler so
angenehm, da es
nahezu überall kleine Buchten gibt, die Schutz vor den
Fährnissen der See
bieten und manchmal da hat es dann auch geklappt mit den Gastarbeitern
und es wurde
nicht nur eine kleine Bucht aus dem Fels gehauen, sondern ein schlanker
Fjord,
was dann das Heimweh für die Götter
erträglich machte. Ein solches antikes
Terraformingprojekt war das Ziel des vierten Tages. Wir setzten alles
Zeug das
da war, also Groß- und Focksegel und kamen gut voran, bis es
dann plötzlich
grau wurde und zu regnen anfing. Ich blieb allein an Deck
zurück und nutzte die
Gelegenheit einen dieser kosmischen Momente zu erleben in denen man mit
sich
und dem Universum allein ist und versteht, einfach versteht –
alles. |
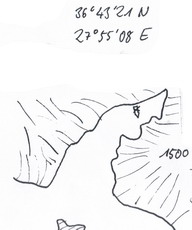 |
Man sitzt
einfach da, den Elementen ausgesetzt, von ihnen buchstäblich
getrieben,
grau-blaue, rau-unbewegte See, feucht-kalter Wind schlägt
über Deck, treibt uns
mit fünf Knoten voran und der Verklicker zeigt träge
nur das Offenbare.
Unvergeßlich und tiefer rührt es ans Herz des
Menschen als alle Liebe der Welt,
wenn man es schafft in solchen Augenblicken ganz bei sich zu sein. Es
hilft
übrigens, wenn man sich vorher kurz mit Herrn Bowmore oder
Fräulein Laphroaig
bespricht, die in derlei Fällen meist sehr hilfsbereit sind.
Die
Einfahrt in den Fjord gestaltete sich ungleich einfacher
als das Ankern. Aufgrund bestehenden Verbotes musste eine Stelle an der
Westseite gefunden werden. Intuitiv als günstig erscheinende
Plätze waren schon
belegt. Wir hatten mit Untiefen, Steinen, der Ankerkette und den Leinen
zu
kämpfen – nichts davon war so lang wie der
Charterfirma angegeben hatte. Günter
und Oliver kamen lange nicht aus dem Wasser heraus, welches
zugegebenermaßen
angenehm warm war. Endlich gelang es doch Halt mit dem Anker zu finden,
und mit
vier vorschriftsmäßig aneinander geknüpften
Festmacherleinen die Entfernung zum
nächsten Baum zu überbrücken. Die
Anstrengungen des Tages wurden belohnt, als
ein Fischer längsseits kam, um seinen Fang feilzubieten, der
uns ein
hervorragendes Abendmahl lieferte. Der Fjord war am Ende des Tages
recht voll,
auch hatte sich eine Motorjacht eingefunden, was das allgemeine Niveau
doch
sehr senkte; sicherlich zur Freude des Katamarans, der bis dato das
Geschwür am
hiesigen Arsch der Welt bildete, in welchen wir so tief
hineingekrochen, dass
auch im schlimmsten Sturme mit einer ruhigen Nacht zu rechnen gewesen
wäre.
Passend zum Euvre des Ortes arbeitete die Besatzung inzwischen
erfolgreich an
einer angemessenen olfaktorischen Untermalung. Zumindest konnte das
Knoblauchproblem für heute gelöst werden, wenngleich
sich herausstellen könnte,
dass vier Knollen für eine Mahlzeit von fünf Herren
möglicherweise zu viel sein
könnten. Der Skipper indes bestand auf seiner wiederholten
Feststellung, dass
das Knoblauchbrot einmal mehr nicht nach Knoblauch geschmeckt habe.
Eine
endgültige Beurteilung des infragestehenden Umstandes wurde
auf den folgenden
Tag verschoben, an welchem überprüft werden sollte,
ob sich benachbarte Yachten
zu übereilten Ablegemanövern provozieren lassen,
indem man sich ihnen
schwimmend nähert.
Die Piratenbucht
ist
ein nettes Restaurant in Dresden, in dem Getränke in
irdenen Krügen gereicht werden und ein kleines Bier einen
halben, ein großes
dann gleich zwei Liter fasst. Außerdem war es der Ankerpunkt
des vierten Tages,
der bereits nach spektakulär kurzer, aber dafür
flotter Fahrt erreicht wurde.
Leider hieß die Piratenbucht gar nicht so, sondern Serce
Limani, diente
dereinst aber mal als solche und wenn nicht, dann waren die Jungs
ziemlich
blöde, denn sie ist sehr geräumig mit enger Zufahrt,
die sich hervorragend
verteidigen lässt (gutes Schussfeld bei hervorragender Deckung
in den
umgebenden Felsen). Die Küste ist so eigenartig geformt, dass
man an der
Einfahrt schnell mal vorbeifährt, ohne sie zu bemerken. Wir
haben sie natürlich
gleich gefunden, aber man erkennt die Zufahrt tatsächlich erst
so richtig als
solche, wenn man sie bereits durchfährt. Es gibt hier keinen
Steg zum
festmachen, sondern Moorings, was recht angenehm ist, wenn man eh nicht
beabsichtigt an Land zu gehen oder ein Beiboot hat mit dem man an Land
übersetzen kann. Was unangenehm an der Piratenbucht war sind
die Fallwinde, die
dort durch ein enges Tal aus Nordost hineinbrettern und Assoziationen
zu einem
Windkanal aufkommen lassen. Vielleicht sind die Piraten deshalb da weg.
Ich für
meinen Teil habe elendig gefroren, was auch nicht wirklich schlimm war,
denn
das eigentliche Problem war unser verunfallter Skipper, der
während eines
dramatischen Auftrittes auf dem Niedergang abrutschte.
Glücklicherweise war
nichts so richtig kaputt gegangen, sondern es tat alles nur weh und
auch nur
ihm.
Wenn
man ein Beiboot hat oder schwimmen kann und gern
durchnässt in Tavernen hockt, dann kann man sich von einem
Nachfahren der
Piraten recht ordentlich bekochen lassen. Der Laden war jedenfalls voll
und
vielleicht hat er bis heute so viel eingebracht, dass ein
anständiger Steg zum
Anlegen in die Bucht gepflanzt wurde.
 |
Der
folgende Tag war dann eher zum abgewöhnen. Wir waren
inzwischen recht sicher, dass der Skipper noch mal Glück
gehabt hatte, aber er
war doch recht eingeschränkt in seiner
Bewegungsfähigkeit, was die Crew
zunächst ordentlich forderte, dabei aber auch tüchtig
Fahrt abwarf – erstmal.
Dann kam die Flaute und wir mussten … also wir …
na ja … wir sind dann halt
gegen Mittag zu unserem Bestimmungsort (Ciftlik Bükü)
gekommen und mussten, als
wir da waren, keine Segel einholen.
Der
Rest des Tages war dann doch wieder sehr OK. Es gab Strom,
wirklich kaltes Bier und abends Lamm am Spieß, das wir uns
mit der Besatzung
der „Finch“ teilten. Diese mir bis dato
völlig unbekannten Leute entpuppten
sich als unmittelbare Landsleute von mir, was dahingehend
ungewöhnlich ist,
dass ich aus einer Gegend Deutschlands stamme, die wirklich
erschütternd dünn
besiedelt ist (man kennt sich) und keine maritime Vergangenheit hat.
|
Zurück
an Bord kam es dann noch zu beträchtlichem
Alkoholmissbrauch, der allerdings nötig war, um unsere
intellektuell tiefschürfendsten
Diskussionen emotional kontrollierbar zu halten.
Marmaris
Über
dem Atlantik befand sich ein barometrisches Minimum; es
wanderte ostwärts, einem über Russland lagernden
Maximum zu, und verriet noch
nicht die Neigung, diesem nördlich auszuweichen. Die
Lufttemperatur stand in
einem ordnungsgemäßen Verhältnis zur
mittleren Jahrestemperatur. Der
Wasserdampf in der Luft hatte seine geringste Spannkraft, und die
Luftfeuchtigkeit war recht gering, mit einem Wort: Es war ein
schöner Tag. Es
sollte der letzte Tag auf See werden, und dieser letzte Tag begann wie
so
vieles, das je zu beginnen schon angefangen hatte mit einem
zünftigen
(Kater-)Frühstück an Deck, mit dem besonders der
Skipper sichtlich zufrieden
war, denn endlich, endlich, endlich breitete sich einmal ein angenehm
wohliges
Knoblaucharoma über seine geschundenen Geschmackspapillen aus.
Quelle war eine
unscheinbare und bisher verschmähte Billigwurst aus einem
Bodrumer Süpermarkt,
die im Übrigen keinen Knoblauch enthielt.
Um
nach Marmaris zu kommen musste ich ein letztes mal das
Großsegel nach oben kurbeln. Das ist immer ganz toll und ein
prima Argument, um
nicht der zu sein, der dann rumturnen muss, um den Bullstander zu
setzen. Der
Skipper besteht meist auf diesen Sicherungsstrick, weil er Leute mit
abpem Kopf
nicht abkann. Wir waren dann jedenfalls wieder viel
schmetterlingsmäßig
unterwegs, weil der Wind von hinten kam. Wiedereinmal fuhren wir unter
Segeln
in den Hafen ein, was bei einem so großen Hafen wie dem von
Marmaris mit so
viel Verkehr wie in Marmaris von Vorteil ist, weil man
gegenüber den
motorisierten Kollegen Vorfahrt hat. Theoretisch! Türkische
Sportbootfahrer
wissen so was beispielsweise gerne mal nicht oder sie wissen es, machen
sich
damit aber keinen Stress, da sie eh viel schneller sind als die Segler,
was
praktisch gesehen ein echtes Argument ist, aber nur solange man keinen
todesgeängstigten hysterisch kreischenden parasailenden
Touristen im Schlepp
hat, wie der Kollege, der unser Kielwasser kreuzte.
Naturgemäß war er schnell
wieder vor uns weg, aber sein Anhängsel nicht und so kam die
Leine unserem Mast
näher und näher und die Kreischwurst wurde lauter und
lauter. Der Turbopropper
konnte das natürlich nicht hören in seinem Flitzer,
aber uns ging das schon auf
die Nerven, so dass der Skipper dann irgendwann abdrehte –
also mit dem Boot.
Nachdem wir
erfolgreich festgemacht hatten war die Reise
vorüber. Da gab es dann noch eine letzte Nacht auf dem Boot,
eine
Bootsübergabe, Stadtbesichtigungen, Basarbesuch inklusive
Feilschen, dramatische
Nassrasuren von witzigen Jungtürken mit scharfen Messern,
öffentliches
schuhegeputztbekommen (Ist ihnen schon mal aufgefallen, dass es in
Deutschland
zu wenig Schuhputzer gibt?), kollektives wasserpfeiferauchen und
anderer
Tourikram, aber das ist eigentlich unwichtig und nicht von allgemeinem
Interesse, da es das Übliche ist. Das Übliche aber
ist bei Sail 200X nicht das
Gewollte und darum will ich jetzt hier auch nicht weiter davon sprechen
respektive schreiben. Wovon man aber nicht sprechen kann, davon soll
man
schweigen.
Anmerkung des Autors:
Dem wahrscheinlich
recht belesenen und hoffentlich geneigten
Leser wird möglicherweise aufgefallen sein, dass der Text
bisweilen Anleihen
diverser Literaten enthält. Dies hat zunächst die
Funktion sie zu unterhalten,
indem sie sich nun auf die Suche machen können um die
bewussten Stellen den
Autoren und Werken zuzuordnen, weshalb ich sie auch nicht auf die
übliche Weise
gekennzeichnet habe, denn das nähme ihnen ja den ganzen
Spaß. Außerdem ist es eine
Verbeugung vor den Kollegen und ihrer über die Maßen
bewundernswerten Fähigkeit
die Dinge so über die Maßen richtig und
schön auszudrücke
Lars Meinecke
Zurück
|